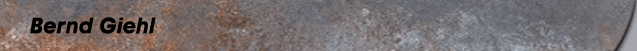| | 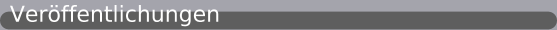
 Bernd Giehl Bernd Giehl
LEONIE ODER WAS WIRKLICH GESCHAH
Eine Liebesgeschichte? Kann doch jeder schreiben. (Na ja, fast jeder.) Aber aus einer Ausgangssituation mehrere mögliche Handlungsfäden herausspinnen, die sich hin und wieder einmal verzweigen, das ist schon origineller.
Ein Mann schenkt einer Frau zu Neujahr ein Buch mit einer sehr persönlichen Widmung. Jahre später findet ein anderer Mann - nämlich der Erzähler - dieses Buch in einem modernen Antiquariat. Wer sind die beiden Personen aus der Widmung; wer ist Bert Kampmann, der die Widmung verfaßt, wer Leonie von Haunstein, der er sie zugedacht hat? Der Erzähler, hat beide noch nie gesehen, also macht er sich seine Gedanken. Er erzählt ihre Geschichte so, wie er sie sich vorstellt. Auf einem Wiesbadener Reitturnier läßt er die beiden sich begegnen und später essen sie in einem teuren Restaurant zu Abend, aber dann verzweigt sich die Geschichte auch schon.
Mauer Verlag, Wilfried Kriese, 1998
ISBN: 3-931627-20-9
Auszug aus dem Roman:
Hier könnte es passiert sein. Hier könnte sie stattgefunden haben; jene erste Begegnung von zwei weiter nicht bemerkenswerten Menschen, deren Verwicklungen im Folgenden erzählt werden soll. Hier könnten sie sich zum ersten Mal über den Weg gelaufen sein, hier auf dem Wiesbadener Reit- und Fahrturnier des Jahres 1990. Ob es dieses Turnier in jenem Jahr schon gab? Ich weiß es nicht. Ich werde Erkundigungen einziehen müssen.
Aber das spielt im Augenblick wohl auch keine allzu große Rolle. Was mich im Moment entschieden mehr beschäftigt: es scheint, als ob ich nachlässig würde. „Hier könnten sie sich zum ersten Mal über den Weg gelaufen sein“, habe ich geschrieben. Gemeint war aber etwas anderes: hier könnten sie sich zum ersten Mal wahrgenommen haben.
Nun ja. Ich weiß, Ihr Deutschunterricht ist Ihnen noch sehr unliebsam in Erinnerung. Obwohl Ihr letzter Deutschlehrer ... war der nicht süß? Nein? Also bitte, keine Ablenkungsmanöver mehr. „Über den Weg gelaufen“ - „wahrgenommen“, das ist doch bestenfalls eine dunkle Erinnerung an unleserliche, erbsenzählende Kommentare in roter Schrift, die ein ansonsten blütenweißes Heft verunzierten. Ich verstehe Sie ja. Sie wollen weiterkommen mit diesem Buch, das Sie vor ein paar Tagen erst gekauft und zu dessen Lektüre Sie jetzt endlich kommen. Sie wollen wissen, wer die Hauptpersonen dieses Roman sind, und womöglich interessieren Sie auch die Verwicklungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Aber statt Ihnen nun endlich seine Hauptpersonen vorzustellen, stellt der Autor Ihre Geduld auf eine harte Probe, indem er darüber nachgrübelt, ob es im Deutschen einen Unterschied macht, ob man sagt: „Sie sind sich über den Weg gelaufen“ oder ob man formuliert: „Hier haben sie sich zum ersten Mal wahrgenommen.“ Gibt es dafür überhaupt eine Entschuldigung? Was soll ich sagen? Vielleicht dies: es macht schon einen Unterschied. Wenn man in einer ehemaligen Residenzstadt lebt, die sich selbst gern als Großstadt sehen möchte und man der gleichen (gehobenen) Gesellschaftsschicht angehört, ist es fast unvermeidlich, daß man sich hin und wieder über den Weg läuft. Ein Mitglied der guten Gesellschaft gibt einen Empfang, und wen lädt er ein? Im Schauspielhaus - übrigens dem einzigen ernstzunehmenden Theater unseres Städtchens - wird eine Premiere gegeben, und wer nimmt daran teil? Und hinterher - mein Gott, man muß doch schließlich einen schönen Abend würdig ausklingen lassen - hinterher braucht man nur die Straße zu überqueren, um in der „Ente vom Lehel“ ein kleines Souper zu sich zu nehmen und dafür ein paar Hunderter liegen zu lassen, falls man nicht gleich zur Kreditkarte greift.
Gut möglich also, daß Frau von Haunstein in Begleitung ihres Gatten (Personalchef einer nicht ganz unbedeutenden Sektfirma Wiesbadens) nach dem Besuch der „Orestie“ in der „Ente“ zu Abend gespeist hat, während Herr Kampmann, (höherer Beamter im Wiesbadener Innenministerium) am Nachbartisch mit Freunden über die Aufführung sprach. Möglich auch, daß man sich sogar für einen flüchtigen Augenblick wahrgenommen hat: ein hochgewachsener Herr in elegantem Schwarz und eine ebenfalls ansehnliche Dame im nachtblauen Abendkleid. Oder man hat im Spielkasino nebeneinander gestanden, als der Herr gerade auf Rouge gesetzt hatte und Schwarz kam. Vielleicht ist man einander sogar schon einmal auf einem Jubiläumsempfang jener Sektfirma, bei der Herr von Haunstein tätig ist, kurz vorgestellt worden. Wie auch immer: selbst wenn ihre Wege sich schon einmal gekreuzt haben sollten (was bei der Größe Wiesbadens und der elitären Einstellung seiner gehobenen Klasse fast unvermeidlich ist) so war es doch nicht mehr als ein flüchtiges Aufeinandertreffen, das innerhalb von drei Minuten so nachhaltig vergessen ist, daß man sich zwei Tage später nicht mehr an die betreffende Person erinnert.
So bleibt es also dabei: begegnet, ich meine, wirklich begegnet sind die beiden sich erst beim Wiesbadener Reit- und Fahrturnier des Jahres 1990, und zwar genau in dem Moment, als der Reiter mit der Startnummer 029 patzte. Überall auf den Rängen gab es ein tiefes Aufstöhnen. „So ein Pech“, kommentierte Bert Kampmann, und Frau von Haunstein stöhnte: „Armer Axel.“
Wie das Leben so spielt.
 Bernd Giehl Bernd Giehl
Schwandorfs Schatten
Was macht ein Journalist, der bei einer kleinen Zeitung angestellt ist, wenn er plötzlich der Story seines Lebens auf die Spur kommt? Er verfolgt unerbittlich diese Spur. So wie ein Jäger das Wild. Oder wie ein Tiger seine Beute.
Jochen Kröger, der Ich-Erzähler dieses Buchs ist hinter einem Industriellen her, den er für einen Fälscher hält. Kröger glaubt, dass Max Schwandorf, der Gründer und Chef von „Schwandorf Computer Systems“ nicht der Mann ist, für den er sich ausgibt. Wie besessen recherchiert er diese Geschichte, weil er an Werte wie Wahrheit glaubt. Allerdings muss er am Ende feststellen, dass die Wahrheit niemand interessiert. „Die Welt will betrogen sein“, das ist sein Fazit gegen Ende des Buchs.
Ein Buch über die Fälschung der Welt, an der wir jeden Tag teilhaben. Und darüber, dass auch das Aufdecken der Wahrheit keine Konsequenzen hat. Dass auch er selbst keine Ausnahme von der Regel ist, dass auch er sich selbst und andere betrügt, muss er schmerzhaft feststellen. Die Schlüsse, die Kröger aus all dem zieht, sind sicher fragwürdig. Aber die eigentliche Frage ist, ob es so etwas wie ein richtiges Leben im Falschen geben kann.
Mauer Verlag, Wilfried Kriese, 2003
ISBN: 3-937008-53-5
Auszug aus dem Roman
Manchmal wache ich jetzt auf und weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich liege in einem großen, alten Holzbett mit runden Pfosten. Vor mir steht ein großer dunkler Bauernschrank, und einen Moment lang frage ich mich, warum Herr Hoppenstedt den noch nicht gepfändet hat. Unmöglich, dass er den übersehen haben könnte. Wo er doch sonst jeden Gegenstand sieht, der mehr als fünfzig Mark gekostet hat. Und dann setzt ganz allmählich die Erinnerung ein. Herr Hoppenstedt kann mich hier ja gar nicht besuchen. Der ist ja immer noch für den Norden von Frankfurt zuständig, wo er mit seiner abgewetzten Ledermappe und seinem schiefen Lächeln die Treppen hochsteigt und an irgendwelchen Türen klingelt. Und womöglich immer noch auf der Suche nach mir ist, weil es da einen Zahlungsbefehl über 352,97 DM gibt für Jochen Kröger, Gerhart Hauptmann Ring 22 in der Frankfurter Nordweststadt. Nur dass sie da keinen Jochen Kröger mehr kennen.
Und dann schleiche ich auf nackten Füßen zum Bauernschrank, wo auf dem obersten Regalbrett ein schöner schwarzer Aktenkoffer liegt. Vorsichtig lasse ich die Schlösser aufspringen – schließlich will ich Maria Concetta nicht wecken, die noch schläft und von der um diese Zeit nur die schwarzen, langen Haare zu sehen sind – und schaue in den Aktenkoffer. Der Tausendmarkschein, den ich mir als Erinnerung aufbewahrt habe – der Einzige, den ich damals nicht eingezahlt habe – liegt immer noch auf seinem Platz.
Manchmal kommt mir mein neues Leben immer noch völlig unwirklich vor. Dann gehe ich ins Wohnzimmer, öffne den grün gestrichenen Fensterladen und schaue hinaus auf den Rasen hinter meinem Haus, auf den Walnussbaum und die silbrigglänzenden Olivenbäume, die ihre verkrüppelten Äste zum Himmel schicken und so tun, als wären sie wer weiß wer, oder ich gehe in die Küche und schaue mir die Straße vor meinem Haus an, die bald schon in der Hitze liegen wird und wo nur ab und an ein Auto vorbeifährt, weil das Dorf, in den ich jetzt wohne, etwas abgelegen liegt. Hier kommen die Touristen nur selten vorbei. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich sie allzu sehr vermisse. Wenn ich mal wieder den Duft der großen, weiten Welt atmen will, dann fahre ich nach Pisa oder gleich nach Florenz, setze mich ins Café an der Piazza della Signoria oder schaue vom Turm des Doms auf das Gewimmel tief unter mir. Von oben ist Florenz wirklich schön. Und manchmal schaue ich in die Gesichter der Vorübergehenden und frage mich, ob ich nicht doch irgendwann einmal jemandem begegne, der mich von früher her kennt. Und mich dann fragt, ob ich nicht der... sei, der früher einmal beim „Frankfurter Morgen“…
Vermutlich werde ich dann einfach weitergehen und so tun, als verstünde ich kein Deutsch.
Gleich wird Maria Concetta aufwachen und ihre langen schlanken Glieder strecken. Dann wird sie mich in ihrem wunderbar singenden Englisch fragen, wie es mir geht. Und ich werde ihr antworten, dass es mir wundervoll geht.
Wenn sie nicht bald aufwacht, werde ich sie wecken müssen. Obwohl sie das nicht mag. Obwohl sie mich dann für einen Moment immer finster ansieht. Und sich ihr Gesicht erst aufhellt, wenn ich ihr einen langen Kuss gebe. Aber ich brauche sie jetzt. Ich muss meine Arme um sie schlingen und ihren Körper spüren, weil ich sonst nicht sicher sein kann, ob ich nicht doch träume. Wenn sie nicht bald aufwacht, wird Kaczmarek, der zwei Stockwerke unter mir wohnt, wieder anfangen, mit seinen Söhnen zu brüllen, dass man sein Geschrei auch noch drei Etagen über ihm hört, oder Herr Hoppenstedt kommt zu Besuch, um nachzusehen, ob es nicht doch noch etwas gibt, was er pfänden kann.
Maria Concetta soll jetzt sofort aufwachen.

Brüchiges Gelände
zu bestellen beim Autor.
Auszug aus der Erzählung "Sauwetter"
Daß diese Verrückten immer so rasen müssen. Verdammt nochmal. Und von einer Sekunde auf die andere haben die alle Zeit der Welt. Wenn die Kollegen von der Feuerwehr sie rausgeschnitten haben mit ihren Blechscheren und Schneidbrennern. Gott, wie die aussehn. Können von Glück sagen, wenn sie nicht gleich in die Blechwanne gelegt werden. Und hinterher müssen wir dann die Bremsspuren vermessen und die Zeugen befragen. Falls sich welche melden, die den Unfall gesehen haben. Falls alle, die uns auf den Füßen rumtrampeln und im Weg stehn, nicht nur geile Spanner sind, die schon immer mal 'nen Toten sehen wollten, live sozusagen, und nicht nur im Fernsehen. "Wir sind erst später gekommen", sagt die Frau mit den eleganten Stöckelschuhen, die so gut zu diesem Mistwetter passen, "wir haben nichts gesehn." "Und warum sind Sie dann noch hier und behindern die Arbeit der Polizei?"
Kein Wort dazu. Stattdessen schnappt sie sich ihren Mann, schlägt die Wagentür hinter sich zu und startet den Mercedes. Hoffentlich hat der Regen wenigstens ihren Hosenanzug ruiniert. Wieder zwei Gaffer weniger.
"Weißt du, wo der verdammte Krankenwagen bleibt?" frage ich Hilpert. Der schüttelt den Kopf. Die Zigarette, die er sich angezündet hat, hat der Regen schon wieder ausgelöscht. Mit einem Fluch schleudert er sie in den Graben. Wie hilflos das Warten macht. Ich mag gar nicht zu den Verletzten hinsehn. Wenigstens die Spanner sind jetzt weg. Vielleicht wär's ja 'ne Therapie für sie, wenn sie den Angehörigen die Nachricht bringen müßten. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn haben einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Der Wagen ist mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei überschlagen. Die beiden liegen jetzt in der Unfallklinik in Koblenz. Wir hoffen, daß sie durchkommen. Bitte sehr, meine Damen und Herren, ich verzichte gerne zu Ihren Gunsten. Tun Sie sich also keinen Zwang an. Wie neulich, als ich in der Nacht mit Hinzpeter zu der Familie gehen mußte, wie hieß die doch noch gleich, Gerber oder Gerbig oder so ähnlich. Ist ja auch egal. Um kurz vor eins haben wir vor der Tür gestanden. Die ganze Straße dunkel. Und dann geklingelt und geklopft, zehn Minuten warn's bestimmt, bis im Treppenhaus das Licht anging. 's war 'n älterer Mann, der die Tür aufschloß, so um die sechzig, mit weißen Haaren, im Bademantel. Ob er zu schnell gefahren wär, war das erste, was er sagte. Komisch, daß die Leute immer ein schlechtes Gewissen kriegen, sobald sie nur 'ne grüne Uniform sehn. "Nein", sagt Hinzpeter, aber wir hätten eine schlechte Nachricht. Von seinem Sohn. "Von Gernot"? hat der Alte gefragt. Hinzpeter hat genickt. "Es tut mir sehr leid." "Er ist tot", hat der Alte mit tonloser Stimme gesagt. Hinzpeter hat noch einmal genickt. "Hier ist ein Telegramm vom Auswärtigen Amt. Da steht alles drin. Mehr wissen wir auch nicht." Einen Moment lang hab' ich geglaubt, er kippt uns vor die Füße. Und wir müssen dann gleich den Notarzt alarmieren. Aber dann ist er doch auf seinen zwei Beinen gestanden und hat immer wieder gemurmelt: "Gernot ist tot. Mein Sohn ist tot. Mein Gernot." Als müßt er die Bitterkeit dieser Worte auch wirklich schmecken.
Wenn doch nur der verdammte Krankenwagen endlich käme. Alle rasen sie wie die Bekloppten, nur wenn man einen Krankenwagen braucht, dauert's länger als bei der Behörde.
| |